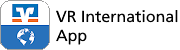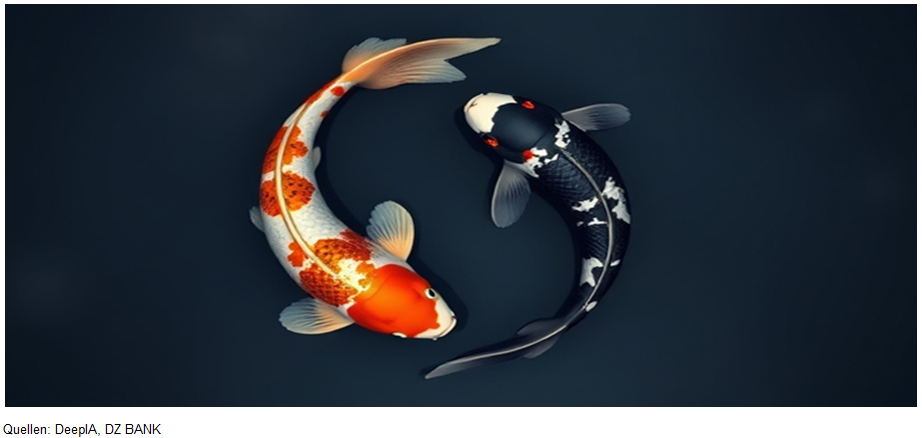Energiekrise eignet sich kaum für ein gemeinsames EU-Fiskalprogramm
In der EU wächst die Sorge vor einem deutschen Alleingang bei der Bewältigung der Energiepreiskrise. Die aktuelle Situation eignet sich aber weniger als die Corona-Pandemie für ein neues EU-Programm.
Deutschlands 200-Milliarden-Euro-Plan zur Linderung der Energiepreiskrise ist zu einem europaweiten Politikum avanciert. Vielfach wird die Kritik laut (vor allem aus Frankreich und Italien), dass Deutschland egoistisch handeln und einen fiskalischen Spielraum zur Bewältigung der Krise nutzen würde, den andere Staaten so nicht hätten. Die Folge: Die Sorge vor Wettbewerbsverzerrungen inmitten einer großen Krise wächst. Die Kritiker stören sich aber weniger an der neuen Ausgabenfreude Deutschlands (die man durchaus kritisch hinterfragen kann), als vielmehr daran, dass nationale Interessen vorangestellt würden. Und so wundert es nicht, dass die EU-Kommissare Breton und Gentiloni in ihrem Namensbeitrag „Nur eine europäische Antwort kann Industrie und Bürger schützen“ (FAZ, 4. Oktober) eine europäische Initiative fordern, die am schuldenfinanzierten SURE-Programm der EU ansetzt. Den Vorteil einer solchen Initiative sehen die Autoren darin, dass die EU eine gemeinsame, koordinierte und vor allem wettbewerbsneutrale Antwort auf die Krise fände. Daher fordern sie, dass die derzeit stark unterschiedlichen Schuldenstandsquoten der Staaten nicht maßgeblich dafür sein sollten, wieviel Schutzmaßnahmen ein EU-Land nun auf den Weg bringen könne.
Dabei erwähnen Breton und Gentiloni nicht, dass es nach dem Aussetzen des Wachstums- und Stabilitätspaktes derzeit ja gar keine strikten politischen Hürden für eine Ausweitung der staatlichen Verschuldung gibt. Jeder Staat könnte also ohne Veto aus Brüssel frei über die Erhöhung seiner Ausgaben entscheiden. Dass vor allem Rom zögern würde, ein Programm wie das deutsche aufzulegen, hat eine ganz andere Ursache: Es fehlt schlicht an Investoren, die bereit wären, eine nochmalige massive Ausweitung der nationalen Verschuldung ohne zusätzlichen Risikoaufschlag zu finanzieren.
Während in der Corona-Krise ein gemeinsames EU-Programm weithin akzeptiert war – Länder wie Italien und Spanien waren auch am stärksten krisengeplagt –, kann man die Notwendigkeit finanzieller Transfers in der aktuellen Krise in Zweifel ziehen. Im Gegensatz zur Corona-Pandemie besteht hinsichtlich der Auswirkungen der Energiekrise innerhalb der EU weniger ein Nord-Süd- als vielmehr ein West-Ost-Gefälle. Deutschland und die MOE-Staaten waren besonders abhängig von russischem Gas und haben zudem auf energieintensive Industrien gesetzt. Die Fehler der Vergangenheit kommen Deutschland nun teuer zu stehen. Umso weniger eignet sich die aktuelle Krise daher als Argument, weshalb die EU-Schulden vor allem zulasten der Hauptgeberländer weiter erhöht und Ansätze in Richtung einer umstrittenen Schuldenunion ausgerechnet jetzt vertieft werden sollten.
-- Daniel Lenz